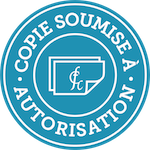„Abstellgleis“ ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, als ich sie hinter all dem grünen Gestänge und den herumwirbelnden Gondeln erblicke. Selbst meine flugzeugaffinen Töchter, mit denen ich heute einen Tag in „Potts Park“ in Minden verbringe, brauchen eine ganze Weile, bis sie die alte „Nord Noratlas“ erblicken. „Was macht denn das Flugzeug da?“, wollen sie wissen. Eine Infotafel gibt es hier nicht. Um die durchaus berechtigte Frage zu beantworten, muss man sich woanders schlaumachen. Zunächst aber ein...
Homepage » Aero-Kultur »
Warum die „Elbeflug“ an der Weser landetepremium
In einer Ecke eines Freizeitparks in Minden fristet eine rund 70-jährige „Nord Noratlas“ ein ziemliches Schattendasein. Wie kam das exotische Flugzeug hierher? Und wo war es vorher im Einsatz?

Die Noratlas im Potts Park flog bis September 1971 beim Lufttransportgeschwader 62 in Ahlhorn. © Meiko Haselhorst
zum Aerobuzz.de
Meiko Haselhorst (Jahrgang 1974) wollte als Kind immer Pilot werden. Doch es kam anders: Er wurde Tischler, später Redakteur einer Tageszeitung – und arbeitet heute als freiberuflicher Journalist. Seine immer noch vorhandene Leidenschaft für Flugzeuge und fürs Fliegen lebt der Vater von zwei Töchtern nun auf Reisen, in der Literatur und an der Tastatur aus. Der Pilotentraum ist aber noch nicht ganz ausgeträumt....