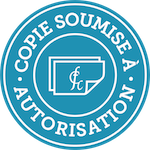Charles Lindbergh ist „der Atlantikflieger“. Das ist so – und wird wohl bis in alle Ewigkeit so bleiben. Richtig ist: Charles Lindbergh war der erste, der von New York nach Paris geflogen ist. Und er war der erste, der den großen Ozean allein in einem Flugzeug überquerte und noch dazu in einem einmotorigen Flugzeug. Im Team hatten das vor ihm bereits 66 Menschen geschafft – die aber allesamt nicht annähernd so berühmt wurden wie der medial gepushte Lindbergh im Jahr...
Homepage » Aero-Kultur »
Die wahren „Atlantikflieger“
Zu seinem 50. Todestag am 26. August schaute die Fliegerwelt mal wieder auf Charles Lindbergh. Dabei hatten vor ihm bereits 66 Menschen den Ozean überquert. Die allerersten waren John Alcock und Arthur Whitten Brown.

Die Vickers Vimy von Alcock und Brown wurde im Ersten Weltkrieg als Bomber entwickelt. © BAE Systems Heritage
zum Aerobuzz.de
Meiko Haselhorst (Jahrgang 1974) wollte als Kind immer Pilot werden. Doch es kam anders: Er wurde Tischler, später Redakteur einer Tageszeitung – und arbeitet heute als freiberuflicher Journalist. Seine immer noch vorhandene Leidenschaft für Flugzeuge und fürs Fliegen lebt der Vater von zwei Töchtern nun auf Reisen, in der Literatur und an der Tastatur aus. Der Pilotentraum ist aber noch nicht ganz ausgeträumt....