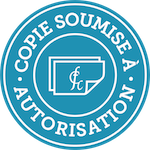Eigentlich ein super Tag zum Fliegen: Der Himmel ist blau, nur hier und da ist ein Wölkchen zu sehen. Und es ist fast windstill. Trotzdem ist nicht viel los am Flugplatz Altenburg-Nobitz, rund 40 Kilometer südlich von Leipzig. Nach einiger Zeit rollt dann aber doch mal eine Cessna 172 zur zweieinhalb Kilometer langen Piste – und hebt nach kurzem Anlauf ab. Sollte er irgendwo hier herumschwirren, der Geist von Melchior Bauer, dann sähe er wohl mit einer gewissen Genugtuung auf...
Homepage » Aero-Kultur »
Melchior Bauer – es fehlten nur ein paar Talerpremium
Hätte man Melchior Bauer im Jahr 1765 etwas Geld gegeben, wäre er heute ein berühmter Mann - vielleicht. So aber ist der deutsche Flugpionier (fast) völlig in Vergessenheit geraten.

Der Entwurf des Himmelswagens von Melchior Bauer verfügte schon über wichtige Elemente späterer Flugzeuge. © Meiko Haselhorst
zum Aerobuzz.de
Meiko Haselhorst (Jahrgang 1974) wollte als Kind immer Pilot werden. Doch es kam anders: Er wurde Tischler, später Redakteur einer Tageszeitung – und arbeitet heute als freiberuflicher Journalist. Seine immer noch vorhandene Leidenschaft für Flugzeuge und fürs Fliegen lebt der Vater von zwei Töchtern nun auf Reisen, in der Literatur und an der Tastatur aus. Der Pilotentraum ist aber noch nicht ganz ausgeträumt....